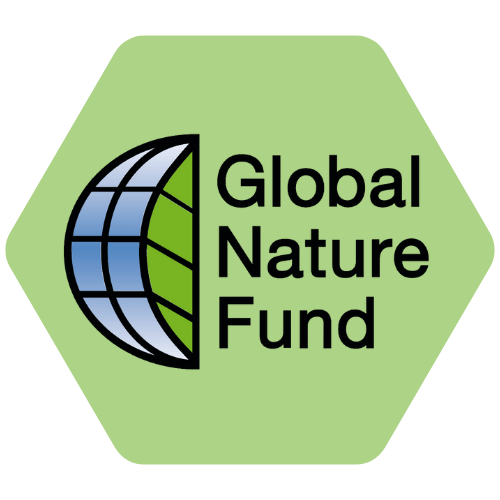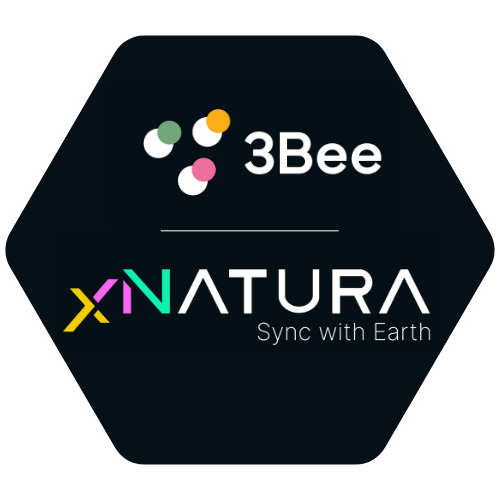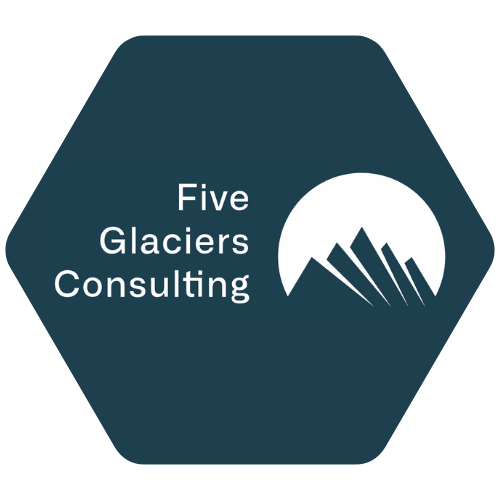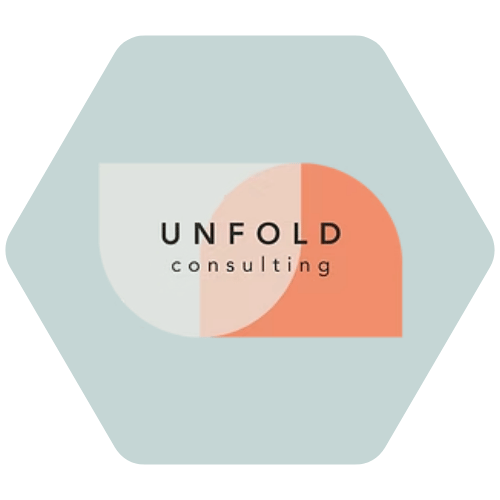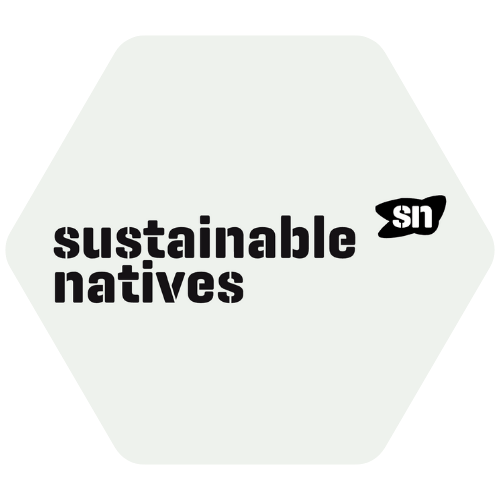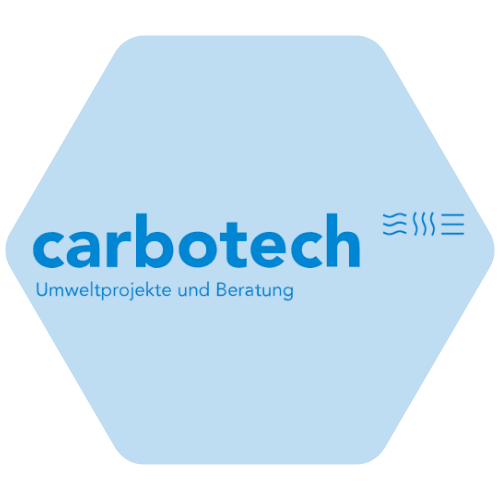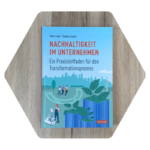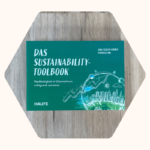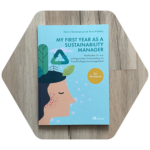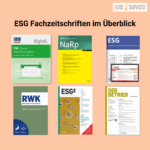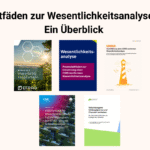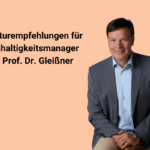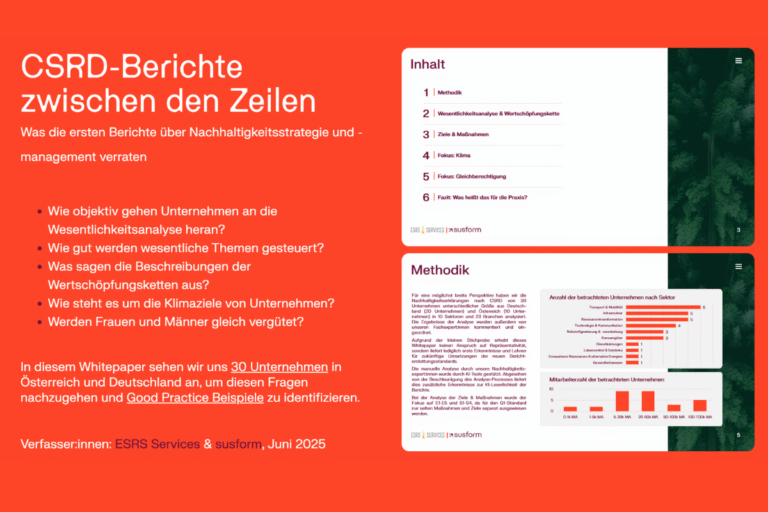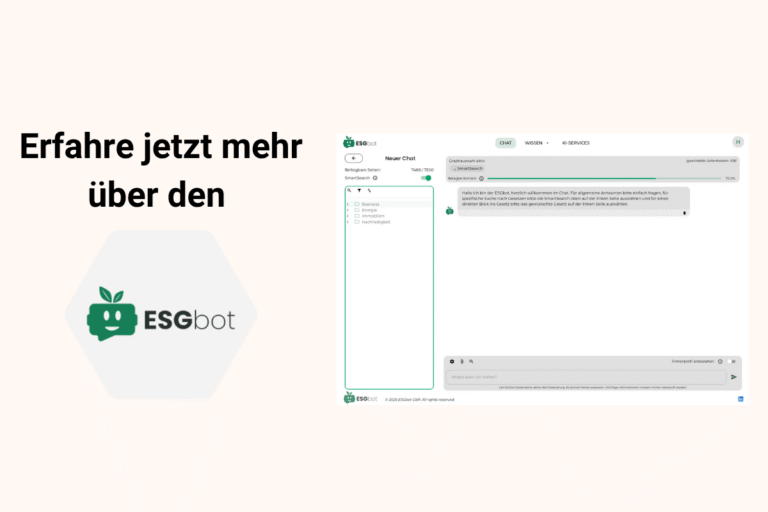Das erwartet Dich
- Die klassischen 6 Schritte zur Durchführung eines Biodiversitätscheck in Unternehmen.
- Nützliche Tipps für jede einzelne Phase des Biodiversitätschecks.
Biodiversität als unternehmerische Herausforderung und Chance
Biodiversität bezeichnet die Vielfalt des Lebens auf der Erde. Sie umfasst neben der Vielfalt der Arten auch die genetische Vielfalt und die Vielfalt ganzer Ökosysteme. Der letzte IPBES-Bericht zeigt, dass die Aussterberate derzeit zehn- bis hundertmal höher liegt als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre, überwiegend durch menschliche Aktivitäten wie Umweltverschmutzung, invasive Arten, Klimawandel, Landnutzungsänderungen oder direkte Übernutzung von Arten (z. B. Überfischung). Die planetare Grenze für biologische Vielfalt ist bereits deutlich überschritten.
Biodiversität ist damit längst nicht mehr nur ein ökologisches Thema, sondern als die Grundlage unseres Lebens und Wirtschaftens Teil der unternehmerischen Verantwortung. Unternehmen sind dabei auf doppelte Weise betroffen: als Verursacher von Biodiversitätsverlust und als Betroffene, deren Geschäftsmodelle von intakten Ökosystemen abhängen. Artensterben, Habitatsverlust und genetische Verarmung wirken sich auf Lieferketten, Ressourcenverfügbarkeit und gesellschaftliche Akzeptanz aus. Entsprechend steigt der politische und regulatorische Druck, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen (z. B. ESRS E4, EUDR, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, SDGs).
Ein strukturierter Biodiversitäts-Quick-Check unterstützt Unternehmen dabei, Biodiversität systematisch zu analysieren und in Managementprozesse zu integrieren. Er kann Anforderungen relevanter Rahmenwerke wie TNFD oder SBTN vorbereiten, indem er Hotspots identifiziert, Stakeholder einbindet und erste Metriken definiert.
Was ist ein Biodiversitäts-Quick-Check überhaupt?
Ein Biodiversitäts-Quick-Check (im Folgenden BQC) bietet einen fokussierten Einstieg in das Biodiversitätsmanagement. Er eignet sich insbesondere für Unternehmen, welche noch keine Biodiversitäts-Strategie haben oder ihre Strategie aktualisieren möchten. Der BQC ist gleichermaßen für kleine und mittelständische wie auch für große Unternehmen geeignet. Ziel ist die Erfassung zentraler Auswirkungen und Abhängigkeiten von der Biodiversität (im Sinne der doppelten Wesentlichkeit) sowie eine erste Standortbestimmung zu den daraus resultierenden Risiken und Chancen.
Dabei handelt es sich nicht um eine vollumfängliche Analyse, sondern um eine kompakte und niedrigschwellige Standortbestimmung zum Thema Risiken, Abhängigkeiten und Chancen. Indikative quantitative KPIs können dennoch als Ergebnis hervorgehen. Der Prozess sollte Stakeholder-zentriert gestaltet sein und sowohl interne als auch externe Fachleute einbeziehen. Auf Basis dieser ersten Orientierung können anschließend sowohl tiefergehende Analysen auf Basis des LEAP-Frameworks (Locate, Evaluate, Assess, Prepare) der TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) als auch erste strategische Handlungsoptionen abgeleitet werden.
Wie läuft so ein Check in der Praxis ab?
Aus der Praxis hat sich ein sechsstufiger Ablauf für einen BQC bewährt. Er ist pragmatisch aufgebaut und orientiert sich an zentralen Prinzipien internationaler Standards wie dem SBTN-Stepwise-Ansatz (Assess, Prioritize, Set, Act, Track) sowie dem TNFD-LEAP-Framework (Locate, Evaluate, Assess, Prepare).

Phase 0: Scoping und Commitment
Vor der eigentlichen Analyse ist es entscheidend, den Rahmen klar abzustecken und das Commitment der Führungsebene zu sichern. Diese vorgeschaltete Phase stellt sicher, dass der BQC strategisch eingebettet ist.
- Zieldefinition schärfen: Was soll mit dem Check konkret erreicht werden? (z. B. Risikobewertung für einen bestimmten Geschäftsbereich, Vorbereitung auf ESRS E4, Identifikation von Innovationspotenzialen).
- Scope festlegen: Welche Unternehmensbereiche, Standorte und Wertschöpfungsstufen werden betrachtet? Eine anfängliche Eingrenzung (z. B. auf die direkten Aktivitäten und die erste Lieferantenebene) ist oft sinnvoll.
- Ressourcen und Team definieren: Wer leitet den Prozess (Process Owner) und wer ist der Sponsor (Vorstand)? Welche Abteilungen müssen von Anfang an involviert werden (z. B. Einkauf, Produktion, F&E, Finanzen, Recht, Management)? Sicherstellung der notwendigen personellen und zeitlichen Kapazitäten.
Phase 1: Vorbereitung
Die Vorbereitung sollte durch das interne Nachhaltigkeitsteam prozessual eng begleitet und idealerweise gesteuert werden. Für diesen Schritt sind in der Regel etwa zwei Wochen einzuplanen. Die genaue Zeit hängt insb. von der Anzahl der Standorte, der Datenzugänglichkeit sowie der Teamgröße ab.
Primäres Ziel dieser Phase ist ein Verständnis über das Unternehmen zu schaffen. Relevante Leitfragen sind hierbei:
- Welche Produkte und Dienstleistungen werden angeboten?
- Welche Rohstoffe werden beschafft?
- Welche Aktivitäten (Logistik, Produktion etc.) fallen an welchen Standorten an?
- In welchen Regionen liegen die wichtigsten Lieferkettenaktivitäten?
Besonders die Standortfrage ist entscheidend, da Biodiversität im Gegensatz zum Klimawandel sehr standortspezifisch ist. Diese Phase orientiert sich am „Locate“-Schritt des TNFD-Frameworks. Zur ersten Hotspot-Erkennung werden webbasierte Tools wie der WWF Biodiversity Risk Filter oder ENCORE genutzt. Diese Instrumente enthalten bereits komplexe geografische Daten und bewerten das standortspezifische Risiko, ohne dass eine eigene GIS-Expertise im Unternehmen notwendig ist.
Zur besseren Veranschaulichung der Ergebnisse empfiehlt es sich, die Standorte mit dem höchsten Risiko auf einer einfachen Karte (z. B. via Google Maps oder in einer Präsentation) visuell hervorzuheben. Dies schafft eine klare und verständliche Diskussionsgrundlage für die nächsten Schritte.
Für diesen Prozess sollte primär auf verfügbare Informationen wie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte und Lieferantenlisten zurückgegriffen werden. Die oben genannten Fragen lassen sich effizient mittels eines standardisierten Online-Fragebogens (max. 30 Fragen) erfassen. Das reduziert Rückfragen und gewährleistet eine transparente Dokumentation.
Ergebnis dieser Phase ist eine erste Standortliste mit grober Risikoeinstufung (z. B. auf Basis eines Risikoscorings 1-5 nach Standort-Sensitivität, Aktivitätseinfluss, regulatorsichem Kontext; Hotspots ab >3) sowie eine konsolidierte Datengrundlage für die folgenden Schritte.
Phase 2: Stakeholder-Workshop
Auf Basis der konsolidierten Informationen aus der Vorbereitungsphase sollte als nächstes ein strukturierter (Halb-)Tagesworkshop durchgeführt werden. In diesem wird zunächst ein gemeinsames Verständnis auf Basis der vorbereiteten Informationen geschaffen. Für die Strukturierung des Workshops hat sich eine modulare Agenda mit klar definierten Zeitfenstern und Deliverables (z. B. Top-10 Impacts/Dependencies, Risiko-Register, Prioritäten-Matrix und Maßnahmenentwürfe inkl. Kosten/Nutzen) als hilfreich herauskristallisiert. Anderenfalls besteht das Risiko, sich gerade in diesem breiten Themengebiet zu verrennen.
Weiterhin ist es sinnvoll, dass das Nachhaltigkeitsteam (Excel-)Templates für ein Impact-Driver-Dependency-Mapping (d.h. eine Matrix, die aufzeigt, welche Treiber im Geschäftsmodell zu welchen Auswirkungen auf die Natur führen und wo Abhängigkeiten von Ökosystemleistungen bestehen) sowie (digitale) Whiteboards vorbereitet, damit Ergebnisse direkt dokumentiert werden.
Im Workshop werden direkte und indirekte Auswirkungen, Risiken und Abhängigkeiten entlang der Wertschöpfungskette identifiziert. Hierfür sollten interdisziplinäre Teams aus der Geschäftsführung, der Logistik, dem Einkauf, der Produktion und der Nachhaltigkeit zusammenkommen. Diese Zusammenstellung stellt u.a. sicher, dass Entscheidungen bereits im Workshop gefällt werden können. Externe Stakeholder können darüber hinaus eine wertvolle Perspektive bieten.
Sind Auswirkungen, Abhängigkeiten und Risiken identifiziert, sollten diese grob auf Basis der Wesentlichkeit priorisiert und erste indikative Vorschläge für Zielsetzungen und geeignete Maßnahmen in den wesentlichen Feldern diskutiert werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Zielsetzung an dieser Stelle nur qualitativ erfolgen kann, da eine quantitative Analyse den Rahmen des Workshops sprengen würde. Um eine SMART-Formulierung der Ziele langfristig zu gewährleisten, sollten notwendige Quantifizierungen im Backlog festgehalten werden. Es hat sich bewährt, zur Validierung der eigenen Gedanken, öffentlich verfügbare Biodiversitäts-Matrizen zu nutzen. Diese bieten zwar keinen unternehmensspezifischen Blick, aber durchaus sektorspezifischen Input, der geeignet ist, um potenzielle Blind Spots zu identifizieren.
Ergebnis dieser Phase ist eine Liste wesentlicher Themenfelder, kategorisiert in Abhängigkeiten, Chancen und Risiken, sowie erste qualitative Maßnahmenvorschläge.
Phase 3: Indikative Quantitative Analyse
Eine vollständige quantitative Analyse geht über einen Quick-Check hinaus. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, die materiellsten Themen aus Phase 2 exemplarisch (semi-)quantitativ mit internen und externen Quellen zu analysieren.
Geeignete externe Quellen für diesen Schritt sind insbesondere:
- WWF Biodiversity Risk Filter; öffentlich: Fokus auf Risikoanalyse basierend auf geografischen Daten und Sektoren
- Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT); lizenzpflichtig: Fokus auf Schutzgebiete und deren Nähe zu Unternehmensstandorten
Ziel ist es, erste, einfach zugängliche Metriken zu definieren (z. B. Flächennutzungsänderung in Hektar pro Standort, Wasserverbrauch in Kubikmetern in wasserarmen Regionen, Anteil zertifizierter biogener Rohstoffe). Wo direkte Daten fehlen, kann mit fundierten Proxys gearbeitet werden (z. B. Einkaufsvolumen eines Rohstoffs als Näherungswert für den Flächenbedarf). So entstehen indikative KPIs, auf deren Basis spätere Detailanalysen aufbauen können.
Weiterhin entsteht ein Eindruck von den benötigten Daten, deren Sammlung für einen Folgeprozess angestoßen werden kann. Dabei sollte von vornherein auf Qualität und Aktualität der Daten geachtet werden und ein geeignetes Datenmanagement frühzeitig etabliert werden, indem z. B. Datenverantwortliche benannt und eine zentrale, nachvollziehbare Ablage für die gesammelten Informationen geschaffen wird. Lücken sollten in diesem Schritt klar dokumentiert werden.
Dieser Schritt ist als explorativ zu verstehen. Komplexere Metriken (z. B. auf Basis von Mean Species Abundance, MSA) und tiefergehende Analysen werden für spätere Phasen vorgemerkt. Ergebnis dieser Phase sind somit insbesondere eine Liste indikativ berechneter KPIs und eine Übersicht identifizierter Datenlücken.
Phase 4: Ergebnisdokumentation und Umsetzung
Die Ergebnisse des BQC werden in dieser Phase zusammengefasst protokolliert – in der Regel durch das Nachhaltigkeitsteam. Festgehalten werden sollte:
- eine Prozessbeschreibung,
- eine Darstellung der Wertschöpfungskette mit identifizierten Biodiversitäts-Hotspots (sowohl bezogen auf die Wertschöpfungskette als auch auf Geografien),
- erste Maßnahmenvorschläge,
- sowie indikative KPIs.
Diese Dokumentation dient nicht nur der Nachvollziehbarkeit, sondern ist Grundlage für strategische Anschlussfähigkeit. Sie sollte daher möglichst früh mit bestehenden Risikomanagement- und Strategieprozessen verknüpft werden.
Phase 5: Follow-Up und Monitoring
Da es sich um einen Quick-Check handelt, ist es notwendig, sich schon im Prozess Gedanken über die nächsten Arbeitsschritte zu machen. Hierfür haben sich drei Schritte bewährt. Zum einen sollte ein Monitoringplan inkl. KPI-Dashboard erstellt werden, in dem KPIs, Erhebungsintervalle und Verantwortlichkeiten definiert werden.
Weiterhin sollten priorisierte Pilotprojekte gestartet werden. Die Priorisierung erfolgt nach Risiko-Score, Machbarkeit (Zeit und Kosten), Einflussgrad und potenziellen Co-Benefits bzw. Synergien zu anderen Unternehmensaktivitäten. Beispiele für solche Pilotprojekte wären Lieferanten-Engagement zur Förderung regenerativer Anbaumethoden oder standortbezogene Schutz- und Renaturierungsprojekte.
Letztlich sollte ein internes Biodiversitätsteam etabliert werden, welches die Weiterentwicklung der Strategie aktiv steuert und mindestens jährlich Prozesse, Maßnahmen und KPIs anhand definierter Meilensteine überprüft und anpasst.
Ergebnis der finalen Phase ist somit ein Monitoringplan mit klaren Verantwortlichkeiten sowie Startmaßnahmen für priorisierte Handlungsfelder.
Was kann ein Biodiversitäts-Check leisten und was nicht?
Der Biodiversitäts-Quick-Check ist ein effektiver und ressourcenschonender Einstieg in das unternehmerische Biodiversitätsmanagement. Sein Hauptzweck ist es, schnell Transparenz über die wesentlichen Schnittstellen eines Unternehmens zur Natur zu schaffen. Er identifiziert erste Abhängigkeiten, Auswirkungen, Risiken und Chancen entlang der Wertschöpfungskette und fördert das organisationsweite Bewusstsein für das Thema.
Als Ergebnis liefert der BQC eine erste Ist-Analyse, eine Übersicht relevanter Hotspots an Standorten und in Lieferketten sowie eine Liste möglicher Metriken und qualitativer Maßnahmen. Diese Erkenntnisse dienen als Katalysator für den interdisziplinären Dialog und schaffen eine solide Basis für strategische Entscheidungen. Sie ermöglichen die Ableitung einer Roadmap für ein umfassenderes Management und die Integration erster KPIs in bestehende Nachhaltigkeits- und Risikomanagementsysteme.
Es ist jedoch entscheidend, die Grenzen eines BQC zu verstehen. Er liefert ein indikatives Bild auf Basis von Näherungswerten und qualitativen Einschätzungen, keine wissenschaftlich belastbare, quantitative Folgenabschätzung im Sinne der detaillierten Anforderungen von TNFD oder SBTN. Der Check ersetzt weder eine tiefergehende, standortspezifische Analyse noch eine fundierte Impact-Messung. Die Ergebnisse sind ein interner Kompass und sollten bei externer Kommunikation klar als explorativ gekennzeichnet werden.
Fazit: Warum sich ein Biodiversitäts-Quick-Check lohnt
Obwohl die Biodiversitätskrise eine ebenso große Bedrohung wie die Klimakrise darstellt, ist das Thema in vielen Unternehmen noch wenig verankert. Die Komplexität standortspezifischer Auswirkungen und das Fehlen etablierter Kennzahlen wirken oft abschreckend. Genau hier setzt der Biodiversitäts-Quick-Check an: Er bietet einen fokussierten, strukturierten und niedrigschwelligen Einstieg, um diese Hürden zu überwinden.
Mit vergleichsweise geringem Ressourceneinsatz ermöglicht der BQC Unternehmen, sich proaktiv auf steigende Anforderungen vonseiten der Regulierung, des Finanzmarktes und der Kunden vorzubereiten. Risiken werden frühzeitig erkannt, Chancen für Innovation und eine Stärkung der Resilienz systematisch aufgedeckt und das Unternehmen nachhaltiger aufgestellt. Der Quick-Check ist somit keine einmalige Übung, sondern der strategische Startpunkt für ein fundiertes Biodiversitätsmanagement, das schrittweise vertieft und weiterentwickelt werden muss. Nur so können Unternehmen langfristig ihrer Verantwortung für den Schutz der Natur gerecht werden und ihre eigene Zukunftsfähigkeit sichern.
Weißt Du, wie Dein Unternehmen die Artenvielfalt beeinflusst?
Mit Five Glacier Consulting erhältst du kompetente Unterstützung bei deinem Biodiversitätscheck – von der Analyse bis zur Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen für mehr Artenvielfalt.
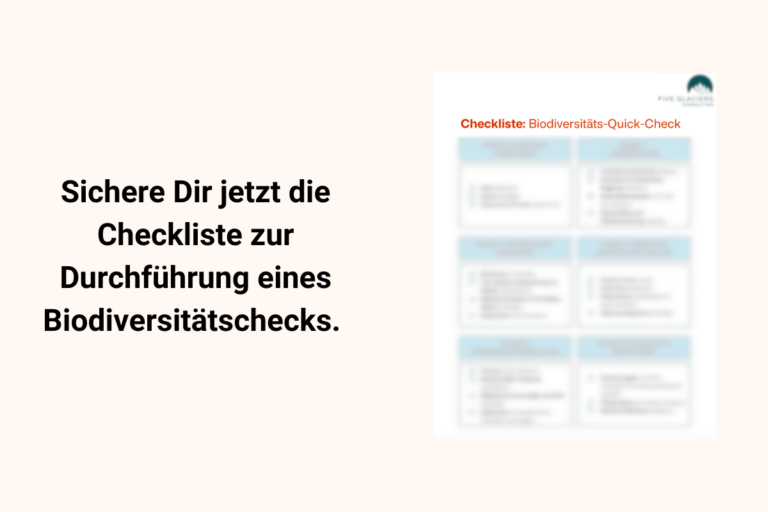
Neu: Der Biodiversitätscheck
Wie der Einstieg in das Thema Biodiversität gelingt.
Ein Biodiversitätscheck bietet Unternehmen einen strukturierten und fundierten Einstieg in das Thema Biodiversität. Er dient als erste Orientierung und verschafft einen Überblick darüber, welche Berührungspunkte das Unternehmen mit dem Themenfeld Biodiversität hat.
Alles rund um den Biodiversitätscheck:
- Grundlagenwissen von A bis Z
- Konkrete Entscheidungshilfen
- Umsetzungswerkzeuge und -Tools
- Best Practices
- Ein Pitchdeck von Beratungen, die mit Euch einen Biodiversitätscheck durchführen wollen
- Zahlreiche Goodies unserer Partner (Checklisten, Standortanalysen & Co)
Mit Fachbeiträgen von: