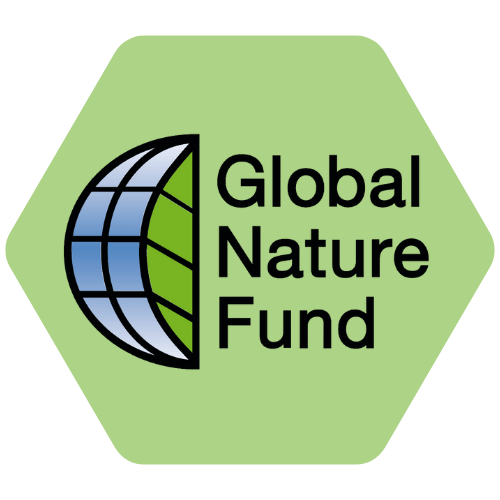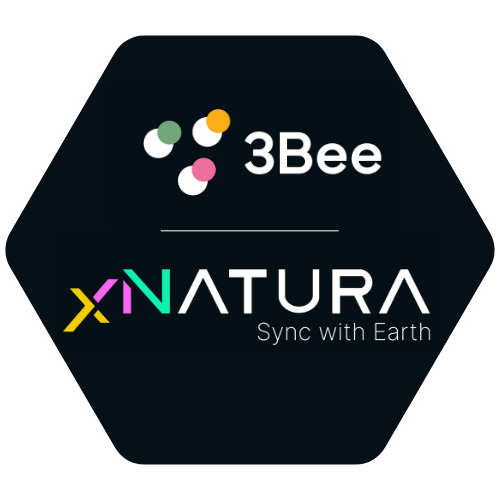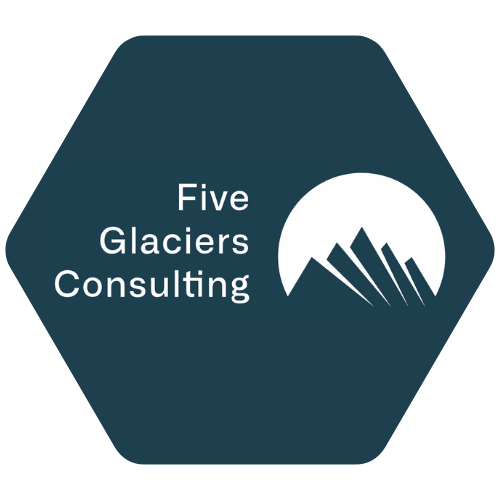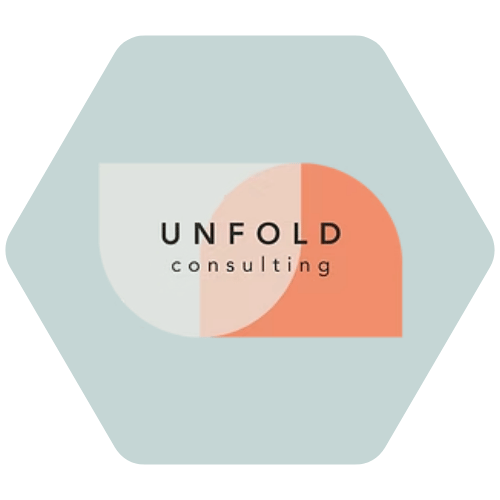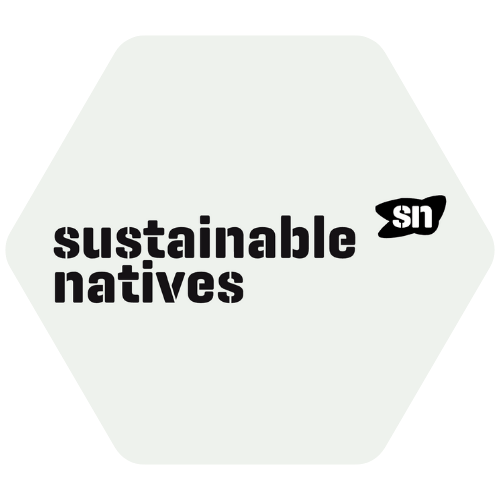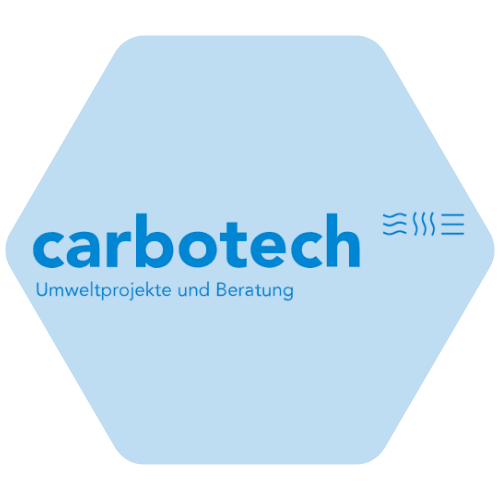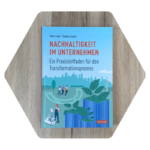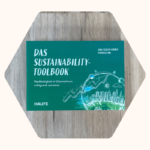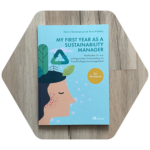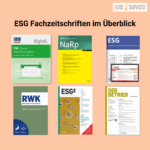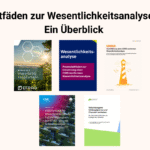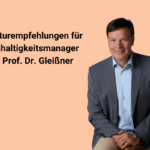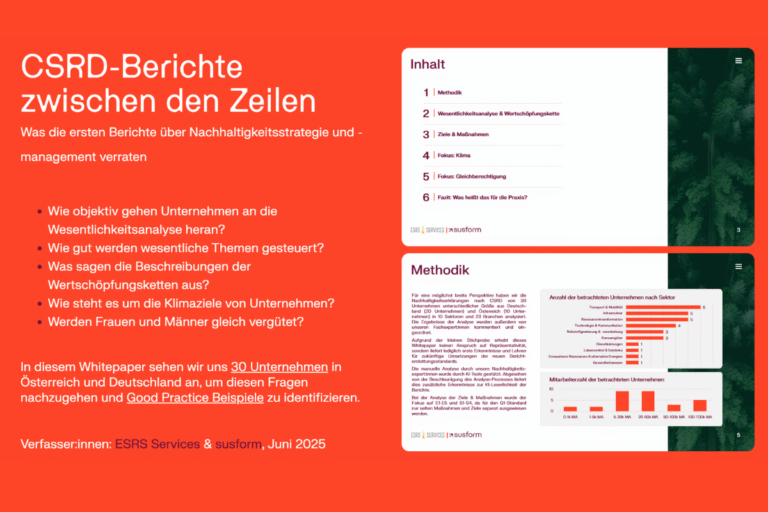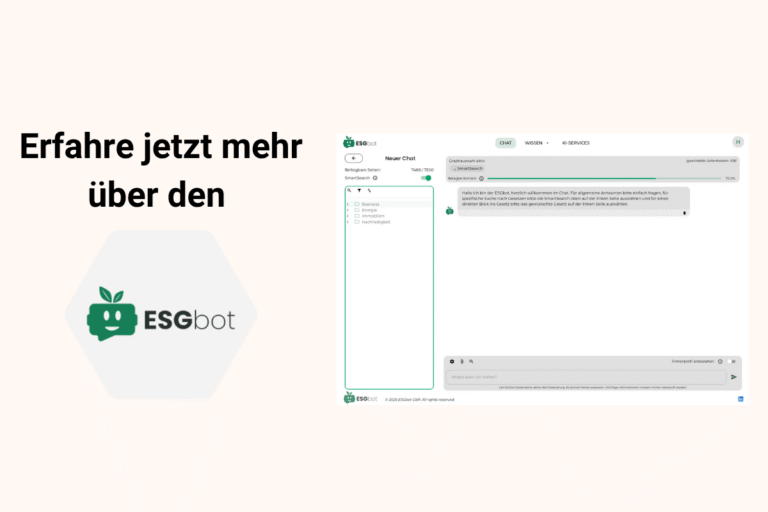Wie Unternehmen mit Daten, Standortwissen und Strategie den neuen ESRS E4-Anforderungen begegnen
-
Biodiversität wird strategisch relevant:
Sie ist kein „Nice-to-have“ mehr, sondern Teil der ESRS-E4-Anforderungen und damit ein Pflichtfeld für Unternehmen mit wesentlichen ökologischen Wechselwirkungen. -
Praxis- und Berichtsnutzen:
Ein Biodiversitätscheck liefert belastbare Daten für ESG-/CSRD-Berichte, erleichtert die interne und externe Kommunikation und eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, sich strategisch als verantwortungsbewusst und zukunftsfähig zu positionieren.
Biodiversität strategisch denken – jetzt ist der Zeitpunkt
Die Biodiversitätskrise ist längst Realität – doch in vielen Unternehmen bleibt das Thema noch unbehandelt. Während sich CO₂-Reduktion, Energieeffizienz oder Kreislaufwirtschaft zunehmend in Strategie und Berichtswesen etablieren, wird Biodiversität oft als „grünes Nice-to-have“ behandelt.
Das könnte sich grundlegend ändern: Mit dem im Juli 2025 veröffentlichten Exposure Draft des überarbeiteten ESRS E4 („Biodiversity and Ecosystems“) erhalten Unternehmen erstmals einen konkreteren Entwurf, wie sie ihre Auswirkungen auf Biodiversität und ihre Abhängigkeiten von natürlichen Systemen identifizieren, steuern und künftig berichten sollen. Zwar handelt es sich derzeit noch um einen Konsultationsentwurf, doch der Text zeigt bereits deutlich, welche Anforderungen in der finalen Fassung zu erwarten sind.
Auch wenn der überarbeitete Exposure Draft von ESRS E4 die Anzahl der verpflichtenden Datenpunkte reduziert hat, bleibt Biodiversität ein zentrales Thema im Kontext der CSRD – insbesondere für Unternehmen, die erhebliche ökologische Wechselwirkungen entlang ihrer Wertschöpfungskette aufweisen. Für diese stellt ESRS E4 weiterhin einen anspruchsvollen Berichtsrahmen dar. Zugleich steigt die strategische Relevanz: Biodiversität entwickelt sich zunehmend zu einem Indikator für Zukunftsfähigkeit, Resilienz und Stakeholder-Akzeptanz.
Der Einstieg in eine fundierte Auseinandersetzung mit Naturkapital gelingt am besten mit einem klar strukturierten Biodiversitätscheck, wie beispielsweise dem Bee friendly Biodiversitätscheck, der Standortkontext, Wirkung und Maßnahmen systematisch analysiert.
Der Biodiversitätscheck: Von der Fläche zur Strategie
Ein Biodiversitätscheck bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Naturbezüge systematisch zu erfassen – mit minimalem Aufwand, aber maximaler Wirkung. Er wurde so entwickelt, dass er sowohl ökologisch belastbare Ergebnisse liefert als auch direkt auf die Anforderungen der ESRS E4 (Juli 2025) abgestimmt ist.
Damit wird der Check zur zentralen Grundlage für Strategieentwicklung, Maßnahmenplanung und Berichterstattung. Der Ablauf folgt dabei einem logischen, praxisbewährten Dreischritt: Standortscreening, Vor-Ort-Erhebung und Bewertung mit Handlungsempfehlungen.
Schritt für Schritt: Wie der Biodiversitätscheck abläuft
1. Standortscreening: Kontext und Risiko erkennen
Im ersten Schritt analysieren die Expert:innen den geografischen und ökologischen Kontext des Unternehmensstandorts. Dabei wird geprüft, ob sich dieser in oder in der Nähe von biodiversitätssensiblen Gebieten befindet. Dazu zählen unter anderem Natura- 2000-Gebiete, FFH-Flächen oder renaturierungsbedürftige Areale gemäß dem neuen EU Nature Restoration Law. Dieser Schritt entspricht direkt den Anforderungen der Disclosure Requirements in ESRS E4, in der Unternehmen verpflichtet sind, die standortspezifischen Auswirkungen auf Biodiversität aufzuzeigen. Das Standortscreening liefert genau diese Grundlage – ergänzt durch visuelle Karten-Ausschnitte (z. B. aus Natura 2000 oder Schutzgebiets-Datenbanken), die zur ersten Orientierung und späteren Dokumentation in Berichten verwendet werden können.
2. Vor-Ort-Erhebung: Ökologische Realität sichtbar machen
Im zweiten Schritt erfolgt eine strukturierte Begehung des Unternehmensstandorts. Dabei erheben Biodiversitätsberater:innen die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort – unabhängig davon, ob es sich um einen Produktionsstandort, ein Logistikzentrum oder eine Dienstleistungsfläche handelt.
Die Erhebung umfasst unter anderem die Erfassung der Pflanzenvielfalt, der vegetationstypischen Strukturen (z. B. Wiesen, Hecken, Gehölze), den Grad der Versiegelung sowie mögliche Lebensräume für Flora und Fauna. Auch Hinweise auf Potenziale zur Renaturierung, Entsiegelung oder ökologischen Aufwertung werden dokumentiert.
Diese Beobachtungen werden fotografisch und systematisch dokumentiert. Sie bilden nicht nur die Basis für die Einordnung von Maßnahmen und Zielen, sondern ermöglichen es auch, konkrete KPIs für das spätere Monitoring zu definieren – zum Beispiel mit Tools wie dem Insector-System zur Erfassung von Insektenaktivität von Bee friendly.

3. Bewertung und Handlungsempfehlung: Vom Status Quo zur Strategie
Auf Basis der Vor-Ort-Daten erfolgt eine strukturierte Bewertung: Welche ökologischen Risiken bestehen? Gibt es indirekte Auswirkungen auf umliegende Schutzgebiete? Welche Potenziale zur Aufwertung bestehen auf dem Gelände? Wo lassen sich Quick Wins realisieren, die ökologische Wirkung mit geringem Aufwand kombinieren? Wo müsste man längerfristig investieren, um Ökosysteme nachhaltig zu stärken?
Auf dieser Grundlage wird eine konkrete Handlungsempfehlung erstellt – vom Maßnahmenset über Prioritäten bis hin zu Monitoring- und Kommunikationsoptionen. Die Ergebnisse sind direkt anschlussfähig an ESRS E4 und können in Strategie-, Compliance- und Kommunikationsprozesse übernommen werden.
Was sich mit ESRS E4 (Juli 2025) konkret geändert hat
Mit der überarbeiteten Entwurfsfassung des ESRS E4 hat sich die Landschaft für die Biodiversitätsberichterstattung deutlich verändert – sowohl formal als auch inhaltlich.
Weniger formale Pflichten – aber klarere inhaltliche Erwartungen
Im Vergleich zur Fassung von November 2022 wurde die Anzahl der verpflichtenden Offenlegungspflichten („Disclosure Requirements“) von neun auf zwei reduziert – ein Rückgang von rund 77,8 %. Diese Reduktion zielt darauf ab, die Berichterstattung für Unternehmen mit nicht wesentlichen Biodiversitätswirkungen zu entbürokratisieren. Gleichzeitig wurde die Struktur des Standards grundlegend überarbeitet:
- Die verbleibenden Disclosure Requirements sind nun präziser gefasst,
- methodische Vorgaben wurden in sogenannte Application Requirements (ARs) überführt,
- optionale Inhalte und Detailausführungen wurden in ein separates Dokument („NonMandatory Illustrative Guidance – NMIG“) ausgelagert.
Fokus auf Wesentlichkeit, Standortkontext und internationale Zielsysteme
Auch wenn die Pflichtangaben reduziert wurden, zeigt der Entwurf klar: Für Unternehmen mit wesentlichen Biodiversitätswirkungen bleibt der Handlungsdruck bestehen – und die Anforderungen an Qualität und Nachvollziehbarkeit steigen. Die neuen Schwerpunkte umfassen:
- Standortspezifische Berichterstattung: Unternehmen müssen betroffene eigene Standorte benennen – insbesondere, wenn diese in oder nahe an biodiversitätssensiblen Gebieten liegen (z. B. Natura 2000).
- Verbindung zu globalen Rahmenwerken: Der Standard betont die Ausrichtung auf das Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) sowie auf die EU-Biodiversitätsstrategie 2030.
- Verzahnung mit anderen ESRS: Die Interdependenz mit ESRS E1 (Klima), E2 (Verschmutzung), E3 (Wasser) und E5 (Ressourcennutzung) wird systematisch herausgestellt – Biodiversität wird als Querschnittsthema verstanden.
Unternehmen, die Biodiversität als nicht wesentlich einstufen, erhalten künftig mehr Flexibilität. Für alle anderen bleibt die klare Botschaft: Biodiversität ist kein Nischenthema, sondern Teil einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie.
Aus der Praxis: Was Unternehmen wirklich davon haben
In der Praxis zeigt sich immer wieder: Der Check ist mehr als ein ökologisches Audit. Er öffnet Türen. Für mehr Wissen im Unternehmen. Für neue Handlungsansätze. Und für strategische Klarheit.
- Ein Kunde aus der Medizinproduktebranche wollte seine bereits umgesetzten Maßnahmen durch eine unabhängige Einschätzung validieren lassen und verstehen, welche Potenziale für weitere biodiversitätsfördernde Maßnahmen an und rund um den Standort bestehen. Der Check half dabei, nicht nur den Status Quo ökologisch einzuordnen, sondern auch bestehende Initiativen gezielter zu kommunizieren – etwa im Rahmen der CSRD-konformen ESG-Berichterstattung.
- Ein weiteres Beispiel stammt aus einem großen Industrieunternehmen, das im Zuge der strategischen Weiterentwicklung seiner Nachhaltigkeitsstrategie ein besseres Verständnis der biologischen Vielfalt auf den eigenen Flächen gewinnen wollte. Ziel war es, mit Hilfe des Biodiversitätschecks eine belastbare Ausgangsbasis zu schaffen, um daraus systematisch neue Maßnahmen abzuleiten. Das Unternehmen plant, sich damit als aktiver Vorreiter gegenüber Kunden und Lieferanten zu positionieren – im Sinne eines glaubwürdigen ESG-Verständnisses entlang der Lieferkette.
3 Praxistipps für den Einstieg
- Beginnen Sie mit einem Standort – nicht mit einer Konzernstrategie.
Erfahrungen zeigen: Wer klein anfängt, kann Wirkung zeigen. Ein Pilotprojekt an einem Standort liefert nicht nur belastbare Daten, sondern schafft intern Akzeptanz und Motivation. - Nutzen Sie Open Data für die Standortanalyse.
Kostenfreie Kartendienste wie Natura 2000 Viewer oder Biodiversity Data Portals helfen, erste Lageeinschätzungen vorzunehmen – oder gemeinsam mit uns im Rahmen des Checks zu vertiefen. - Denken Sie Monitoring von Anfang an mit.
Nur wer Fortschritt misst, kann ihn zeigen – und berichten. Mit Systemen wie Insector lassen sich Bestäubung, Insektenaktivität und Lebensraumqualität erfassen – ideal für ESRS-KPIs oder Förderanträge.
Fazit
Mit einem Biodiversitätscheck schaffen Unternehmen nicht nur eine fundierte Entscheidungsgrundlage für ihre ESRS E4-konforme Biodiversitätsstrategie. Sie zeigen, dass sie Verantwortung übernehmen – mit Daten, mit Wirkung, mit Weitblick. In einer Zeit, in der Biodiversität vom „grünen Zusatz“ zum Pflichtthema und strategischen ESG-Hebel wird, ist das der klügste erste Schritt: für Natur, Unternehmen und Gesellschaft.
Jetzt kostenloses Kennenlerngespräch buchen
Vereinbare ein kostenloses Erstgespräch mit Sascha Sychov von Bee friendly, um mehr zum Biodiversitätscheck zu erfahren.
One more thing: Dank ESRS Services kannst Du den Insector einen Monat lang kostenlos auf Eurem Firmengelände testen. Sascha bringt den Insector persönlich vorbei und Ihr bekommt Zugriff auf alle gesammelten Daten.

Neu: Der Biodiversitätscheck
Wie der Einstieg in das Thema Biodiversität gelingt.
Ein Biodiversitätscheck bietet Unternehmen einen strukturierten und fundierten Einstieg in das Thema Biodiversität. Er dient als erste Orientierung und verschafft einen Überblick darüber, welche Berührungspunkte das Unternehmen mit dem Themenfeld Biodiversität hat.
Alles rund um den Biodiversitätscheck:
- Grundlagenwissen von A bis Z
- Konkrete Entscheidungshilfen
- Umsetzungswerkzeuge und -Tools
- Best Practices
- Ein Pitchdeck von Beratungen, die mit Euch einen Biodiversitätscheck durchführen wollen
- Zahlreiche Goodies unserer Partner (Checklisten, Standortanalysen & Co)
Mit Fachbeiträgen von: